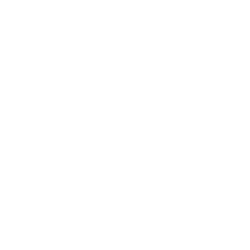Liebe Leserinnen und Leser,
Unsere Kollegin Kerstin Eitner steckt noch in der Sommerpause, daher darf ich sie heute vertreten.
Ich habe neulich ein Hochbeet gebaut, aus gebrauchten Paletten, Messingwinkeln und Schrauben. Nichts besonderes, kein Modell, das man in einem Youtube-Tutorial präsentieren müsste. Für unsere Zwecke aber reicht es. Aufwendiger war es, den Japanischen Knöterich zu bändigen, der dort vorher wuchs. Eine beeindruckend eigensinnige Pflanze, die sich gegen alles und jeden durchsetzt und – laut Internet – pro Tag bis zu dreißig Zentimeter (!) zulegt. Ich habe mich noch nicht mit einem Zollstock daneben gesetzt, bin aber überzeugt davon, dass diese Angabe absolut korrekt ist.
Zum Gärtnern bin ich eher unfreiwillig gekommen. Vor einigen Jahren, als wir in der Stadt – Hamburg – lebten und eine neue Wohnung suchen mussten, wurden wir nicht so recht fündig. Also schauten wir, ob wir außerhalb etwas mieten können. Gelandet sind wir schließlich in einer Kleinstadt, in der ein Garten zur Standardausstattung gehört. Das fühlte sich vertraut und neu zugleich an. Einerseits, weil ich in einer ähnlichen Gegend aufgewachsen bin, andererseits, weil ich trotzdem keine Ahnung hatte, was auf mich zukam. Rasen mähen, klar, aber sonst? Inzwischen weiß ich mehr. Etwa, dass aus mir kein Selbstversorger mehr wird. Oder dass ich jedes Jahr im Herbst aufs Neue staune, wie viel Arbeit das Runterschneiden der Bäume und Büsche verursacht.
Missen möchte ich den Garten trotzdem nicht. Vielmehr denke ich immer häufiger, was für ein Privileg es ist, diesen Rückzugsort zu haben. Während des Lockdowns im Frühjahr 2020 war das der Fall. Mitten in der Hitzewelle, in der so häufig betont wird, wie schlecht unsere Städte auf den Klimawandel vorbereitet sind, ist es wieder so.
Dazu konnte man ja einiges lernen in den vergangenen Tagen. Laufend war von Städten als „Wärmeinseln“ die Rede, was nach Urlaub klingt, aber meint, dass ihr Asphalt und Beton die brennende Hitze aufnehmen, in die Tiefe leiten und nachts wieder abgeben. Hätte man dort mehr Bäume und Grünflächen geplant, könnten diese Schatten spenden und durch ihre Verdunstung zur Kühlung beitragen. Häuser dagegen vergrößern die aufheizbare Fläche, Abgase aus dem Verkehr und der Industrie verstärken den Effekt zusätzlich. Bis zu zehn Grad können die Temperaturunterschiede innerhalb einer Stadt je nach Bebauung betragen, was nochmal zeigt, dass der Klimawandel auch ein gravierendes soziales Problem ist. Wer weniger für seine Miete ausgeben kann und darauf angewiesen ist, in einer Hochhaussiedlung zu leben, womöglich unterm Dach und ohne Balkon, muss jetzt auch höhere Temperaturen hinnehmen. Vor der Hitze ist nicht jeder gleich.
Lässt sich das ändern? Kurzfristig wohl kaum. Stadtplanung ist langfristig angelegt. Immobilien müssen Jahrzehnte halten und werden nicht nach kurzer Zeit wieder abgerissen, weil die Politik merkt, dass Frischluftschneisen, die eine kühle Brise von außen nach innen tragen, doch gut gewesen wären für ihre Stadt. Wie so oft gilt auch hier, dass nicht vorausschauend gehandelt wurde. Jetzt wird notdürftig geflickt, was man versäumt hat. „Hitzeaktionsplan“ nennt sich das dann. Einzelne deutsche Kommunen haben sich so einen Notfallkoffer bereits zugelegt, in anderen Ländern wie Frankreich, Italien, Spanien, Portugal und England wurden nationale Verordnungen erlassen. Werden sie aktiviert, nehmen öffentliche Freibäder keinen Eintritt, es wird Trinkwasser an Obdachlose verteilt und das Personal in Notaufnahmen aufgestockt. Außerdem bleiben Gemeindehäuser, Bibliotheken, Einkaufszentren und Kirchen über Nacht geöffnet, als „Cooling Shelters“.
Was mich trotz der Hitzewelle zuversichtlich stimmt, sind die zahlreichen kleinen Initiativen, die eigenmächtig versuchen, mehr Natur in die Städte zu bringen. Von einer Frau in Brüssel, die mit ihrer Familie in einer Mietwohnung lebt, las ich, dass sie ihren nicht benötigten Parkplatz vor der Tür in einen Mini-Garten verwandelt hat. Als dieser eines morgens verschwunden war, weil die Stadt diese unrechtmäßige Nutzung des öffentlichen Raums auf der Mülldeponie entsorgt hatte, sprangen kurzerhand die Nachbarn ein. Sie schenkten der Familie neue Pflanzen und halfen, den zweiten Garten auf einem Handwagen anzupflanzen. Gegen dieses Gefährt kann die Verwaltung aufgrund eines alten Brüsseler Gesetzes jetzt nichts unternehmen. In Berlin hingegen meldete sich das Grünflächenamt unlängst bei einem Mann, der zwei Jahre lang eine Linde in der Stadt regelmäßig bewässert hatte. Er habe es versäumt, das ordentlich anzumelden, befand das Amt und legte den kleinen Gießring rund um den Baum wieder trocken. Ordnung muß sein, selbst wenn sie den Bäumen das Leben kostet.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie möglichst viel Grün in Reichweite haben und das Grün immer genug Wasser, ohne dass Ihnen jemand dazwischen pfuscht.

Marc Winkelmann
Redakteur
Wochenauslese: Meldungen, Geschichten und Ansichten – (nicht nur) zum Thema Umwelt in Ihr E‑Mail-Postfach
![[object Object] [object Object]](https://gpm-cs.e-fork.net/sites/default/files/styles/abo_header_cover/public/2024-04/gp03-2024_titel_rgb_96dpi.jpg?h=51520478&itok=uyIjGVyb)