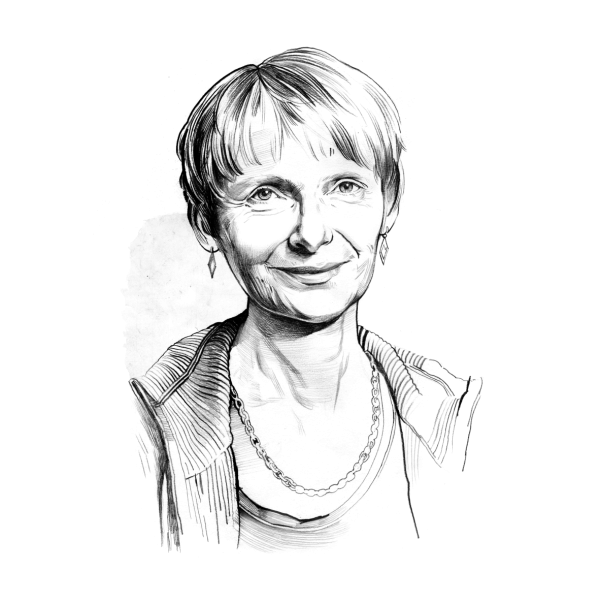Liebe Leserinnen und Leser,
der 10. Juli 1985 schien ein ganz normaler Tag zu sein. Wie an jedem Wochentag in diesem Jahr war ich an meinem Arbeitsplatz im Greenpeace-Büro am Hamburger Elbufer. Es gehörte zu meinen Aufgaben als Assistentin, ein- und ausgehende Fernschreiben zu verteilen und zu archivieren. Fax und Mail waren noch Zukunftsmusik. Schriftliche Nachrichten verarbeitete mit viel Geratter das heute fast ausgestorbene Telex, eine Art klobige Schreibmaschine mit Telefonanschluss, die mit ellenlangen papierenen Lochstreifen gefüttert wurde.
An diesem Tag tickerte eine Nachricht aus dem südenglischen Lewes herein, dem damaligen Hauptquartier von Greenpeace International, die im wahrsten Sinne des Wortes einschlug wie eine Bombe. Ihr Wortlaut in etwa: „Am 10. Juli um kurz vor Mitternacht Ortszeit ist die Rainbow Warrior im Hafen von Auckland nach zwei Explosionen gesunken. Bitte versucht nicht, wiederhole: NICHT, im neuseeländischen Büro anzurufen, alle Leitungen sind blockiert.“
Nun überschlugen sich die Ereignisse: Wenig später stand fest, dass der Greenpeace-Fotograf Fernando Pereira in seiner Kabine ertrunken war, offenbar bei dem Versuch, seine Kamera zu retten. Pereira, gebürtiger Portugiese, gerade 35, hatte mit seiner Frau und zwei Kindern in den Niederlanden gelebt. Zuletzt hatte er dokumentiert, wie die Rainbow Warrior im Mai nach und nach 327 Menschen mit Sack und Pack von der durch den US-Atomtest „Bravo“ verseuchten Pazifikinsel Rongelap auf die weiter südlich gelegene Insel Mejato umsiedelte.
Schnell konnten die hartnäckigen neuseeländischen Ermittler bestätigen, was die Spatzen überall auf der Welt von den Dächern pfiffen: Es war ein Bombenattentat. Agenten des französischen Auslandsgeheimdienstes DGSE hatten das Schiff mit Haftminen versenkt und den Tod von Menschen billigend in Kauf genommen, wenn nicht gar beabsichtigt. Denn wenn ich kurz vor Mitternacht zwei große Löcher in einen Schiffsrumpf sprenge, muss ich annehmen, dass einige Crewmitglieder schlafend in ihren Kojen liegen. Mit der „Opération Satanique“ sollte die Rainbow Warrior um jeden Preis davon abgehalten werden, zur geplanten Protestfahrt gegen französische Atomversuche auf dem Moruroa-Atoll auszulaufen.
Glück im Unglück: Erstens hatte die Crew am selben Abend den Geburtstag des US-amerikanischen Kampagnenleiters Steve Sawyer gefeiert, einige waren noch wach. Zweitens hatten die verschiedenen Agententrupps sich selten dämlich angestellt (was für Spott bei der CIA und dem britischen Geheimdienst MI5 sorgte). Die freundlicherweise hinterlassenen Spuren waren etwa so breit wie die Champs-Élysées. Es ist nicht viel los im Winter in Neuseeland. Da registriert die Bevölkerung seltsames Verhalten vermeintlicher ausländischer Touristen aufmerksam und gibt ihre Beobachtungen auch gern an die Polizei weiter.
Der damalige neuseeländische Premierminister David Lange sprach es als Erster aus: Die Versenkung der Rainbow Warrior in Auckland sei ein „terroristischer Akt“ gewesen. Zwei der Agenten, Dominique Prieur und Alain Mafart, vorgeblich ein Schweizer Paar namens Sophie und Alain Turenge auf Hochzeitsreise (Flitterwochen! Mit dem Campingbus! Im Winter!), wurden schnell festgenommen.
Irgendwann im August bekam ich spät abends einen Anruf: Ich möge doch bitte sofort nach Paris kommen. Das internationale Greenpeace-Team in der französischen Hauptstadt brauche Unterstützung. Damals war mein Französisch ganz passabel. Also hastig gepackt, Bargeld geliehen (Bankautomaten? EC-Karten? Zukunftsmusik, siehe oben), gerade noch in den Nachtzug gesprungen und am frühen Morgen an der Gare du Nord ausgestiegen. Ein paar Wochen lang konnte ich aus nächster Nähe den Reigen von Dementis und Vertuschungsmanövern seitens der französischen Regierung miterleben. Es fühlte sich unwirklich an, dass Greenpeace plötzlich im Zentrum einer Staatsaffäre stand.
Die Presse ließ der französischen Regierung ihre Lügen nicht durchgehen, auch Greenpeace stellte eigene Recherchen an. Im September trat schließlich Verteidigungsminister Charles Hernu zurück, Geheimdienstchef Pierre Lacoste wurde gefeuert. Premierminister Laurent Fabius – jener Fabius, der 30 Jahre später als Außenminister den Pariser Klimagipfel nicht ungeschickt leitete – musste, obwohl selbst an der Verschwörung nicht beteiligt, vor die Kameras treten und alles zugeben. „Die Wahrheit ist grausam“, sagte er.
Prieur und Mafart wurden 1986 in Neuseeland zu zehn Jahren Haft verurteilt und sollten ihre Strafe auf der französischen Militärbasis Hao im Südpazifik verbüßen, konnten aber schon nach weniger als zwei Jahren nach Frankreich zurückkehren. Die anderen acht beteiligten Agenten standen nie vor Gericht. Stattdessen wurden alle später ausgezeichnet und befördert, auch Frédérique Bonlieu alias Christine Cabon, die vorab das neuseeländische Greenpeace-Büro ausspioniert hatte. Admiral Lacoste schrieb 2005 in seinen Memoiren, Staatspräsident François Mitterrand habe die Operation abgesegnet, was man bereits geahnt hatte.
Weltweit erfuhr Greenpeace viel Sympathie, moralische und finanzielle Unterstützung, und gewann neue Mitglieder, außer in Frankreich, wo die Stimmung immer feindseliger wurde. Die MS Greenpeace fuhr anstelle der Rainbow Warrior nach Moruroa, begleitet von einer Flottille aus kleineren Booten. Ein Jahr nach dem Attentat zahlte Frankreich auf internationalen Druck gut sieben Millionen US-Dollar Entschädigung an Neuseeland. 1987 verurteilte ein Schiedsgericht in Genf das Land zu einer Schadensersatzzahlung an Greenpeace in Höhe von über acht Millionen Dollar. Die gesäuberten Überreste der Rainbow Warrior ruhen heute als künstliches Riff auf dem Grund der neuseeländischen Matauri Bay, an Land erinnert ein Denkmal an sie.
Schon früh machte in all dem Chaos dieser Spruch die Runde, vielleicht kam er aus Neuseeland, aber genau weiß ich das nicht: „You can’t sink a rainbow“ – einen Regenbogen kann man nicht versenken. So war es, so ist es, und so wird es bleiben.
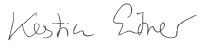
Kerstin Eitner
Redakteurin
Wochenauslese: Meldungen, Geschichten und Ansichten – (nicht nur) zum Thema Umwelt in Ihr E‑Mail-Postfach
![[object Object] [object Object]](https://gpm-cs.e-fork.net/sites/default/files/styles/abo_header_cover/public/2024-04/gp03-2024_titel_rgb_96dpi.jpg?h=51520478&itok=uyIjGVyb)