Lithium ist elementar für die Energiewende – der Abbau schadet aber Klima und Umwelt. Kann die Gewinnung in Europa und durch Geothermie Abhilfe schaffen? Im Greenpeace Magazin 5.22 waren wir im Oberrheingraben zu Besuch
Da hängen sie, die drei Glaszylinder, wie Müslispender im Unverpacktladen. Siebzig Zentimeter hoch, zehn Zentimeter im Durchmesser, angeschlossen an Leitungen, Drehverschlüsse und Messinstrumente, gefüllt mit einem beigen, porösen Stoff, Sorbent genannt. Das ist das Herzstück. Hier bleiben die Lithium-Ionen haften, wenn das Thermalwasser vorbeifließt.
Wenn die Anlage vollständig ausgebaut ist, sollen hier siebzig Liter pro Sekunde durchrauschen und nicht bloß zehn Liter pro Stunde wie derzeit, hochgepumpt aus vier Kilometer Tiefe in einem Geothermiekreislauf, der seine Energie selbst gewinnt und klimaneutral arbeitet. So lautet das Ziel.
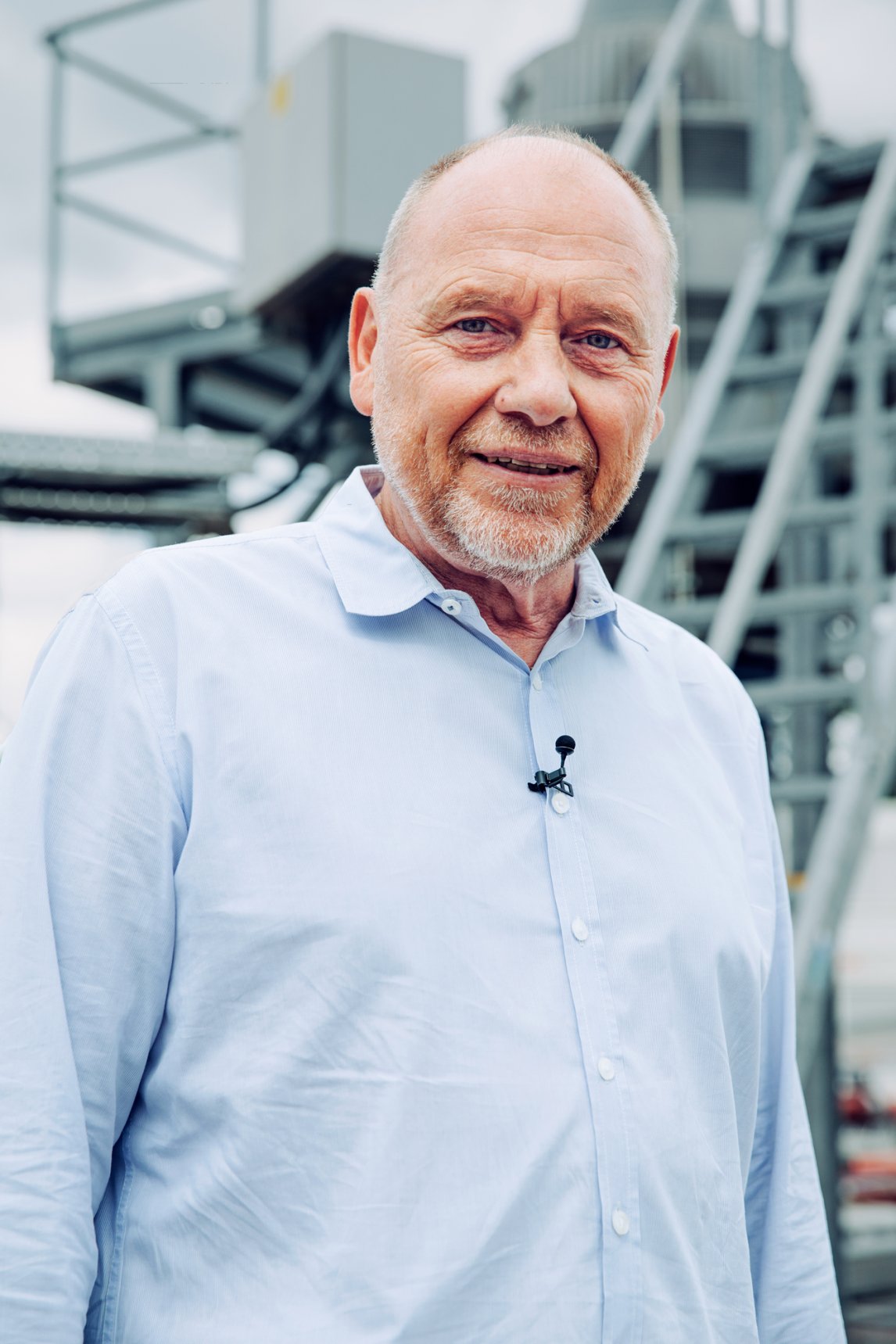
HORST KREUTER
Der Gründer befasst sich seit mehr als zwanzig Jahren mit Geothermie
Bis es so weit ist, müssen aber noch einige Experimente durchgeführt werden, und deshalb hat Thorsten Weimann, Geschäftsführer der Vulcan Energie Ressourcen GmbH, in der Industriehalle im pfälzischen Insheim eine Bitte. Nicht fotografieren, sagt er. Oder nur so, dass man später keine Details erkennt. Die Konkurrenz soll seine Versuchsanordnung nicht nachbauen können.
Ohne Lithium ist keine nachhaltige Zukunft denkbar. Das Leichtmetall ist essenziell für Lithium-Ionen-Batterien, und die sind, mit Ökostrom, ein zentraler Baustein des Plans, die fossilen Energien zu ersetzen. Damit das gelingt, muss wesentlich mehr Lithium produziert werden als heute – im Jahr 2030 etwa viermal so viel. Vor allem für E-Autos. Ein Akku mit einer Kapazität von hundert Kilowattstunden benötigt 27 Kilogramm.
Die rasant steigende Nachfrage nach Batterien hat aber Haken: Der bisherige Abbau des Stoffs schadet der Umwelt und dem Klima. Die Minen kommen mit der Produktion nicht hinterher. Die Preise steigen – allein im ersten Halbjahr 2022 um hundert Prozent. Und weil durch den Krieg in der Ukraine die Lieferketten noch brüchiger geworden sind, müssen jetzt neue Lithiumquellen her. Auch in Europa, wo bisher nur winzige Mengen gewonnen werden. Achtzig Prozent des benötigten Volumens will die EU mittel- bis langfristig aus heimischen Vorkommen beziehen.
Projekte gibt es einige, in Serbien, Tschechien, Spanien, Portugal, England, Österreich, Finnland. In Deutschland plant
ein Unternehmen, Vorkommen im Erzgebirge zu fördern. Am weitesten ist laut Eigenaussage aber Vulcan Energie. Bereits ab 2025 wollen die Macher den begehrten Stoff ausliefern. „Perspektivisch können wir ein Viertel des europäischen Bedarfs abdecken“, sagt Gründer Horst Kreuter. Verträge mit Abnehmern in der Autoindustrie hat er längst geschlossen. „Wer jetzt erst zu uns kommt, kann frühestens 2030 mit einer Lieferung rechnen.“
Der Geologe sitzt in seiner Empfangshalle in Karlsruhe, Hemd über der Jeans, Sneaker, Socken mit Zitronenmotiv, und spricht davon, „das Momentum“ nutzen zu wollen. 3,2 Millionen Tonnen Lithium sollen laut EU unter seinen Füßen im Oberrheingraben lagern, einem 300 mal 40 Kilometer großen Korridor zwischen Frankfurt und Basel. Für den Pilotbetrieb hat Kreuter das Geothermiekraftwerk Insheim an der A65 übernommen, eine halbe Autostunde von der Zentrale entfernt.
 © Anne-Sophie Stolz
© Anne-Sophie StolzGEOTHERMIE-KRAFTWERK INSHEIM
Das 160 Grad Celsius heiße Thermalwasser, das aus vier Kilometer Tiefe hochgepumpt wird (hinten), ist doppelt wertvoll: Erst dient es als Energiequelle für Haushalte – dann wird das Lithium herausgefiltert. Am Ende fließt das Wasser zurück in die Erde (vorne)
Dass der Rohstoff einmal strategisch relevant wird, war lange nicht absehbar. Bisher waren es vor allem Glas- und Keramikhersteller sowie Firmen der Unterhaltungselektronik und Digitalindustrie, die ihn einsetzten. Die massenhafte Produktion von E-Autos in China, den USA und Europa ändert jetzt alles – und verschärft den Run auf die Ressource, wie Michael Schmidt von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) hochgerechnet hat. „Zwar ist Lithium gemessen an den bekannten Vorkommen kein knappes Gut“, sagt er. „Aber selbst wenn alle Projekte in Europa klappen und sie zeitgleich produzieren sollten, müssten wir im Jahr 2030 immer noch etwa siebzig Prozent unseres Bedarfs importieren.“ Und das von Minen, die nicht in der Lage sein werden, die global prognostizierte Nachfrage bis Ende des Jahrzehnts zu bedienen.
Schmutziger Abbau
Gewonnen wird das Metall bislang durch zwei Methoden (Fotos Seite 78). Liegt es in Gesteinen vor, werden diese gesprengt, abtransportiert und gemahlen. Anschließend lässt sich das Pulver veredeln – die Voraussetzung für den Einsatz in Batterien. Australien ist die Hochburg dieser Förderung: Mehr als sechzig Prozent der globalen Produktion stammen aus dem Land.
Die mit Abstand größten Vorkommen dagegen liegen im Dreieck zwischen Bolivien, Chile und Argentinien, in unterirdischen Salz-Wasser-Lösungen. Arbeiter fördern diese Sole und sammeln sie in Becken, wo die Flüssigkeit bis zu zwei Jahre lang verdunstet und den Rohstoff zurücklässt. Bis zu 2000 Milligramm beträgt die Konzentration pro Kilo Sole.
Mit diesem Wert kann der Oberrheingraben nicht mithalten. Hier sind es maximal 220 Milligramm. Dafür bietet die Geothermie einen anderen Vorteil: Sie emittiert laut Vulcan Energie kein CO2. Eine von der Firma kofinanzierte Untersuchung kam zu dem Ergebnis, dass der Ausstoß von Treibhausgasen bei den anderen Abbaumethoden sehr viel höher liegt: 15 Tonnen CO2 entstehen beim Bergbau pro Tonne Lithium – das Brechen und Mahlen des Gesteins, sein Transport und die weitere Aufbereitung verschlingen viel Energie. Bei der Verdunstung sind es nur fünf Tonnen CO2 – ob und wie sehr der hohe Wasserverbrauch bedenklich ist, ist umstritten und nicht abschließend geklärt.
Wie es anders gehen soll, zeigt Thorsten Weimann, Vulcans Leiter des operativen Geschäfts. Mit aufgesetztem Schutzhelm geht er über das Gelände. Ein Geothermiebrunnen pumpt das 160 Grad Celsius heiße Wasser nach oben, ein Labyrinth aus Rohrleitungen führt es zur thermischen Verwertung. Der Dampf treibt eine Turbine und einen Generator an – 8000 Haushalte versorgt das Werk derzeit mit Energie. Danach erfolgt die stoffliche Nutzung. Das Wasser kühlt auf siebzig Grad ab und fließt durch Behälter, die mit einem Feststoff aus Harz gefüllt sind, an den sich die Lithium-Ionen binden. Anschließend wird das Thermalwasser wieder in die Erde gepresst, das Harz ausgewaschen und die erhaltene Lösung zu Lithium-Hydroxid konzentriert. „Wir gehen davon aus, dass wir mit dieser und weiteren Anlagen in der Region 40.000 Tonnen im Jahr produzieren können, was die Autoindustrie für rund eine Million E-Fahrzeuge nutzen kann“, sagt Weimann.
Ist das der perfekte Kreislauf? Selbsterhaltend, nachhaltig, zukunftsweisend?

DAS HERZSTÜCK
In der Pilotanlage für die Lithiumextraktion fließt Thermalwasser durch Glaszylinder (re.), die mit einem porösen Harz-Feststoff gefüllt sind. Daran haften sich die Lithium-Ionen. Beim Ausspülen danach lösen sie sich wieder – die konzentriertere Flüssigkeit wird anschließend zu Lithium-Hydroxid verarbeitet

METHODEN DER LITHIUMGEWINNUNG
Australische Minen fördern den Rohstoff im Tagebau und produzieren weltweit am meisten (oben). Das größte Vorkommen dagegen liegt in Südamerika, dort wird Lithium über Verdunstungsbecken gewonnen
DAS HERZSTÜCK
In der Pilotanlage für die Lithiumextraktion fließt Thermalwasser durch Glaszylinder (re.), die mit einem porösen Harz-Feststoff gefüllt sind. Daran haften sich die Lithium-Ionen. Beim Ausspülen danach lösen sie sich wieder – die konzentriertere Flüssigkeit wird anschließend zu Lithium-Hydroxid verarbeitet
METHODEN DER LITHIUMGEWINNUNG
Australische Minen fördern den Rohstoff im Tagebau und produzieren weltweit am meisten (oben). Das größte Vorkommen dagegen liegt in Südamerika, dort wird Lithium über Verdunstungsbecken gewonnen
BGR-Experte Michael Schmidt hält die Euphorie für etwas verfrüht. „Jedes Kilo Lithium, das in Europa gewonnen wird, ist natürlich zu begrüßen“, sagt er. „Über die Jahre habe ich aber schon zahlreiche Projektentwicklungen gesehen und musste feststellen, dass die Macher vieles sehr rosig darstellen.“ Am Oberrheingraben müssten aber auch noch Grundlagen erforscht werden. Wie viel lässt sich gewinnen? Bleiben die Prozesse über längere Zeit stabil? Wie hoch sind die Kosten – und wie hoch die tatsächlichen CO2-Emissionen? Diese Fragen gelte es zu beantworten.
Auch Klemens Slunitschek vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) spricht nicht von einem perfekten Kreislauf, „das erweckt unrealistische Erwartungen“. Zwar geht er davon aus, dass die Gewinnung im Vergleich „minimalinvasiv“ und damit „deutlich umweltfreundlicher“ ist, auch weil sie regional erfolgt und keine langen Lieferwege nach sich zieht. Aber: „Die Datenlage ist noch zu gering.“
Slunitschek ist am Institut für Angewandte Geowissenschaften beschäftigt und Teil eines vom Bundeswirtschaftsministerium geförderten Projekts, das die Lithiumgewinnung aus Thermalwasser erforscht. Pläne, das Vorhaben auszugründen und die Industrie ganz bald mit Lithium zu beliefern, existieren am KIT derzeit nicht, sagt er. Zunächst will das Team das Labor verlassen und errichtet in Bruchsal gerade eine Pilotanlage, um sowohl die Wirtschaftlichkeit einer großtechnischen Umsetzung als auch deren ökologische Folgen zu untersuchen.
Beben in der Region
Die Geothermie selbst steht dabei nicht im Fokus. Sie ist es allerdings, die im Oberrheingraben immer wieder für Debatten sorgt. Weil die Region tektonisch aktiv ist, fürchten Bürgerinitiativen, dass Bohrungen zusätzliche Beben auslösen können. Sie berufen sich auf Vorfälle wie in Landau im Sommer 2009, als innerhalb von vier Wochen zweimal der Boden mit einer Stärke von bis zu 2,7 auf der Richter-Skala wackelte. Klemens Slunitschek gibt zu, dass man mit Bedacht vorgehen müsse. Andererseits seien in der Vergangenheit Fehler gemacht und Techniken angewendet worden, die man nicht mehr einsetzt. „Aus wissenschaftlicher Sicht kann man eine Geothermieanlage hier bei richtiger Handhabung der Technologie mit gutem Gewissen aufstellen“, sagt er.
Bei Vulcan Energie wissen sie um die Kritik und versuchen, sich ihr zu stellen. „Allein gestern Abend habe ich zwei Gemeinderatssitzungen besucht“, sagt Geschäftsführer Thorsten Weimann. „Die Akzeptanz der Bevölkerung ist immens wichtig.“ Helfen sollen etwa eine geplante Roadshow und ein Infocenter, eine Art „Ort der Begegnung“. Noch sind aber nicht alle überzeugt. „Vor allem Naturschützer und Grünen-Wähler haben eine ambivalente Haltung zur Geothermie und stellen zum Teil Maximalforderungen“, sagt er.
Michael Schmidt plädiert dafür, „erst mal jeder Stimme zuzuhören“, auch wenn es mitunter Interessenvertretungen gibt, die relevante Fakten ignorieren. „Der Dialog muss immer geführt werden“, sagt er und erzählt von einem Gespräch mit dem Bürgermeister von San Pedro de Atacama in Chile. Der erklärte ihm, dass es bei der Lithium-Gewinnung in seiner Region um mehr gehe als nur um das Lithium. Nämlich um die Menschen, die Landwirtschaft, den Tourismus. Dieser Gedanke sollte auf alle Projekte und Länder übertragen werden, so Schmidt. „Der Lebensstandard, den wir wollen, setzt Produkte voraus – und diese haben einen Preis. Monetär, aber auch für den Planeten. Wir als Gesellschaft müssen festlegen, wie viel uns unser Wohlstand ökonomisch und ökologisch wert ist.“ Darüber zu sprechen, sei aber unbequem und wurde mit dem zunehmenden Rückzug des Bergbaus in Deutschland verlernt.
Geht es nach dem Vulcan-Team, kehrt ein Teil jetzt zurück, diesmal, um die Energiewende voranzubringen. Nach der Pilotanlage soll eine Demoanlage entstehen, die 5000 Liter pro Stunde verarbeitet.
Besteht diese alle Tests, folgt der Großbetrieb. Überzeugt davon, dass es klappt, sind Horst Kreuter und Thorsten Weimann. Neben ihrer Förderlizenz für das Kraftwerk Insheim haben sie bereits neun Explorationslizenzen, um weitere Standorte zu erkunden.
Diese Reportage erschien in der Ausgabe 5.22 „Artenvielfalt“. Das Greenpeace Magazin erhalten Sie als Einzelheft in unserem Warenhaus oder im Bahnhofsbuchhandel, alles über unsere vielfältigen Abonnements inklusive Prämienangeboten erfahren Sie in unserem Abo-Shop. Sie können alle Inhalte auch in digitaler Form lesen, optimiert für Tablet und Smartphone. Viel Inspiration beim Schmökern, Schauen und Teilen!
![[object Object] [object Object]](https://gpm-cs.e-fork.net/sites/default/files/styles/abo_header_cover/public/2024-04/gp03-2024_titel_rgb_96dpi.jpg?h=51520478&itok=uyIjGVyb)
