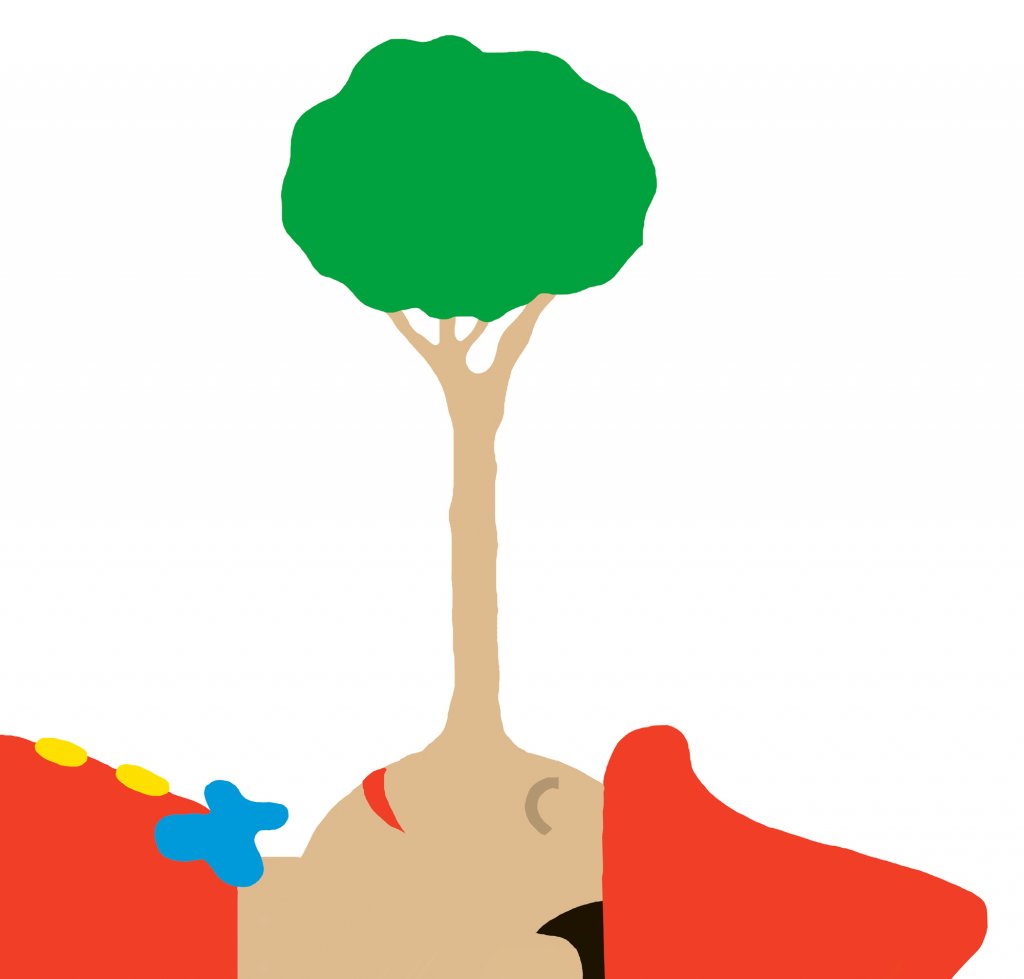Klimaneutralität ist en vogue. Es gibt kaum einen Konzern, der sich nicht mit entsprechenden Ambitionen schmückt. Doch oft steckt auch irreführendes Marketing mit sogenannter CO2-Kompensation dahinter, die dem Klima wenig nützt. Wer es ernst meint, sucht nach neuen Lösungen, schreibt unsere Redakteurin Frauke Ladleif in der Ausgabe 3.21 „Es ist angerichtet“ des Greenpeace Magazins
Grünes Heizöl? Ja, das gibt es – glaubt man der Werbung von Total. Als Betreiber einer Ölheizung könne man „besondere Verantwortung für den Klimaschutz“ übernehmen, heißt es auf der Internetseite des viertgrößten Ölkonzerns der Welt. Wie? Durch den Kauf von „klimaneutralem“ Heizöl.
Wäre „Coronapandemie“ nicht das Wort des Jahres 2020 geworden, „klimaneutral“ hätte womöglich das Rennen gemacht. Der Begriff prangt mittlerweile auf unzähligen Produkten – von der Wurst über den Urlaubsflug bis hin zur Tankfüllung. Doch wer dahinter ein Synonym für „emissionsfrei“ vermutet, der irrt. Denn ohne Schaden fürs Klima sind die Produkte natürlich nicht – das wären sie nur, würden sie gar nicht erst hergestellt und konsumiert.
Hinter dem Euphemismus „klimaneutral“ steht vielmehr ein Konzept, das lange ein Nischendasein fristete, inzwischen aber zentraler Bestandteil von sogenannten Netto-Null-Zielen vieler Konzerne ist und oft auch von deren Produktwerbung: die CO2-Kompensation. In Deutschland ist vielen das Prinzip durch die Non-Profit-Organisation Atmosfair bekannt, bei der Flugreisende ihren ökologischen Fußabdruck durch eine Spende an Klimaschutzprojekte verkleinern können. Nun wollen immer mehr Unternehmen diese Möglichkeit nutzen, um ihre Ökobilanz aufzuhübschen und sich klimaneutral – „net zero“ (netto null) – zu rechnen.
Dabei spenden Firmen für Klimaschutzprojekte in Afrika, Asien und Lateinamerika, etwa für die Erhaltung von Wäldern, das Pflanzen von Bäumen, den Bau von Windrädern oder die Verteilung emissionsarmer Kochöfen. Die so eingesparten oder gebundenen CO2-Emissionen werden in Gutschriften umgemünzt, wobei jedes Zertifikat einer Tonne Kohlendioxid entspricht. Die Firmen kaufen so viele davon, dass sie – jedenfalls rechnerisch – den Ausstoß ihrer Produktion tilgen und Klimaneutralität für sich reklamieren können. Währenddessen blasen sie jedoch weiterhin Treibhausgase in die Atmosphäre.
In einer Umfrage unter deutschen Unternehmen gaben 28 Prozent an, bereits zu kompensieren, weitere 44 Prozent wollen dies künftig tun. Auch auf internationaler Ebene ist ein regelrechter Wettstreit um die – vermeintlich – ambitioniertesten Netto-Null-Ziele entbrannt. So will der Onlinehandelsriese Amazon bis zum Jahr 2040 Klimaneutralität erreichen, Apple schon bis 2030. Der Softwaregigant Microsoft will ab 2030 sogar CO2-negativ werden, also eigene Emissionen aus früheren Jahren der Atmosphäre wieder entziehen.
Viele Unternehmen bemühen sich dabei ernsthaft um mehr Klimaschutz und beteuern, auf dem Weg zur Netto-Null ihren Treibhausgasausstoß vor allem intern zu reduzieren, etwa durch den Umstieg auf Ökostrom und grüne Technologien. Nur „unvermeidliche“ Emissionen wollen sie extern ausgleichen. Doch was unvermeidlich ist, ist eine Frage der Auslegung. Im Februar präsentierte der Ölriese Shell seinen Plan, wie er bis 2040 klimaneutral werden will – unter anderem, indem er bald jährlich 120 Millionen Tonnen CO2 kompensieren möchte. Doch gleichzeitig plant er, noch jahrzehntelang Öl- und Gasreserven auszubeuten. „Unvermeidlich“ sind nach dieser Logik auch die Tankfüllungen der Kunden. Die können schon jetzt ihren Spritverbrauch kompensieren – mit gut einem Cent pro Liter.
Börsennotierte Klimarettung
Der Hype um Kompensationen hat nun auch die Finanzbranche auf den Plan gerufen. Der ehemalige Chef der britischen Notenbank, Mark Carney, der mittlerweile UN-Klimabeauftragter ist, hat vergangenes Jahr eine privatwirtschaftliche „Taskforce for Scaling Voluntary Carbon Markets“ ins Leben gerufen, eine Einsatztruppe also, die den freiwilligen Handel mit CO2-Gutschriften anheizen soll. Ihr gehören Konzerne wie Total, Shell, Siemens, RWE und Easyjet an; unterstützt wird sie vom Institute for International Finance, der globalen Lobbyorganisation der Finanzbranche. Ende Januar stellte Carney auf dem digitalen Weltwirtschaftsforum seine Vision für eine großangelegte Expansion des Kompensationsmarktes vor: Der Handel solle wie an einer Börse funktionieren. Das sei effizienter, aber auch regulierter und glaubwürdiger als bisher.
Denn derzeit kaufen Unternehmen die CO2-Gutschriften meist direkt bei Projektbetreibern oder lassen sich diese über Beratungsgesellschaften vermitteln. Ein zentrales Register und ein staatliches Gütesiegel für die Zertifikate gibt es nicht, stattdessen sollen Standards mit hohem ökologischen und sozialen Anspruch die Qualität und CO2-Minderung sichern, zum Beispiel der von der Naturschutzorganisation WWF mitentwickelte Gold Standard. 2019 wurden so rund hundert Millionen Tonnen Kohlendioxid ausgeglichen, doppelt so viel wie zwei Jahre zuvor. Der Börsenhandel soll nun aber ein Vielfaches davon bringen: Bis 2030 könnte die Nachfrage auf jährlich zwei Milliarden Tonnen CO2 wachsen, prognostiziert die Taskforce, bis 2050 sogar auf bis zu 13 Milliarden. Das wären rund ein Drittel der Emissionen, die die Menschheit derzeit pro Jahr verursacht.
Die Fehler im System
Angesichts dieser Dimensionen rumort es in der Branche gewaltig. Während die einen die Börsenidee als eine Möglichkeit feiern, Milliarden aus der Wirtschaft in den Klimaschutz zu lenken und damit entscheidend zum Erreichen des 1,5-Grad-Ziels des Pariser Abkommens beizutragen, warnen andere vor einem gigantischen Potenzial zum „Greenwashing“.
Denn viele bezweifeln, dass die von der Taskforce bisher vorgeschlagenen Mechanismen zur Qualitätssicherung ausreichen. „Man muss erst die Qualität des zugrundeliegenden Systems sicherstellen, bevor man an die Skalierung des Marktes denkt“, sagt Sabine Frank, Direktorin der Brüsseler NGO Carbon Market Watch. Organisationen, die als besonders glaubwürdig gelten – wie Atmosfair und der Zertifizierer Gold Standard – befürchten, dass ihre Projekte in einen Topf mit Angeboten fragwürdiger Qualität geworfen werden. „Beim Börsenhandel wissen die Käufer nicht, von welchem Projekt sie Zertifikate erwerben, sondern nur, dass es Zertifikate sind, die Minimalanforderungen erfüllen“, sagt Lambert Schneider, der für das Freiburger Öko-Institut den CO2-Handel beobachtet.
Schon lange gibt es Kritik an der Zweckmäßigkeit zahlreicher Kompensationsprojekte. Umweltschutzorganisationen berichten immer wieder etwa von Waldprojekten, bei denen Menschenrechte verletzt werden und nicht gesichert ist, dass die Bäume nicht irgendwann abgeholzt werden. Denn wenn das geschieht, gelangt das in ihnen gebundene CO2 am Ende wieder in die Atmosphäre (siehe Greenpeace Magazin 5.20). Dasselbe gilt, wenn die Bäume etwa infolge des Klimawandels absterben oder abbrennen. Deshalb sind sie als sicherer CO2-Speicher ungeeignet. Ausgerechnet Waldprojekte sind bei Unternehmen aber besonders beliebt – produzieren sie doch schöne grüne Bilder.
„Wie passt das Ausgleichen von CO2 in eine Zeit, in der dieses radikal reduziert werden muss? “
Zudem ist oft fraglich, ob die Projekte Emissionen überhaupt zusätzlich einsparen. Dabei ist das die Voraussetzung für deren Klimanutzen. Denn wenn ein Unternehmen durch den Kauf von Zertifikaten etwa die Installation von Solaranlagen in Ghana unterstützt, werden dadurch nicht automatisch Emissionen eingespart. Entscheidend ist, dass das Projekt ohne die Zahlung nicht stattgefunden hätte. Um diese Zusätzlichkeit zu beziffern, werden komplizierte „Was-wäre-wenn“-Rechnungen angestellt, die zu Betrug und Fehleinschätzungen führen können.
Zusätzliche Einsparungen bringen wohl auch 600 Millionen Zertifikate nicht, die auf jahrealten Klimaschutzprojekten basieren – und die dennoch auf dem Markt sind, weil sie bislang niemand gekauft hat. Das ergab eine aktuelle Untersuchung britischer Wissenschaftler. Sie kritisieren, dass sich Unternehmen damit günstig eindecken können, ohne dass die Zertifikate noch zum Klimaschutz beitrügen. So bezeichnete der Ölriese Total im vergangenen Oktober eine Tankerladung mit Flüssigerdgas als klimaneutral, weil er CO2-Gutschriften von einem Windpark in Nordchina gekauft hatte. Die Windräder laufen jedoch schon seit 2011. Das Projekt sei offensichtlich auch ohne die heutige Finanzspritze von Total entstanden, schreiben die Wissenschaftler, und habe damit sicher nicht zu einer neuen Einsparung von Emissionen geführt.
Sabine Frank nennt solche alten Zertifikate, die teils weit unter einem Euro pro Tonne CO2 zu haben sind, daher auch „Junk Credits“. Ein Anreiz, selbst Treibhausgase zu reduzieren, seien sie nicht.
Carsten Warnecke, Experte für Kohlenstoffmärkte am Kölner NewClimate Institute, spricht angesichts solcher Fehler im System von „Klimaneutralität als Täuschung“. Die Praxis führe dazu, die Lebensdauer klimatisch untragbarer Geschäftsmodelle zu verlängern. „Kompensation als Lizenz, das umweltschädliche Business-as-usual fortzusetzen, führt sogar zu mehr Emissionen“, sagt er. Zwar sei es eine gute Sache, wenn Unternehmen Bäume pflanzten und glaubwürdigen Klimaschutz finanzierten. „Sie sollten den Leuten aber nicht vorgaukeln, ihre Produkte seien dadurch klimaneutral.“
Doppelt verbucht
Nun gibt es eine weitere Herausforderung für den Handel mit CO2-Gutschriften, die das gesamte Konzept des Kompensationsmarktes in Frage stellt. Sie hat mit dem Pariser Klimaabkommen zu tun. Ab diesem Jahr nämlich müssen alle Länder – und nicht mehr nur die Industriestaaten – konkrete Pläne zur Senkung ihres CO2-Austoßes formulieren. Bisher wurden Klimaschutzprojekte nicht nur aus Kostengründen hauptsächlich in Ländern des globalen Südens finanziert, sondern auch, weil diese die CO2-Einsparungen nicht für eigene Klimaziele benötigten. Wenn nun künftig in einem Entwicklungsland ein Waldstück aufgeforstet wird, bestehe die Gefahr, dass die eingesparten Emissionen doppelt in Anspruch genommen würden, sagt Sabine Frank – „sowohl von den Firmen in westlichen Industrieländern, die damit ihre Emissionen gegen null rechnen, als auch von den Regierungen der Gastländer für ihre eigene Klimabilanz“.
Atmosfair und Gold Standard arbeiten daher an speziellen Verträgen, die gewährleisten sollen, dass das Projektland die CO2-Minderungen aus der eigenen Klimabuchhaltung entfernt. „Wir wollen damit sicherstellen, dass Länder die Wirkung ihrer eigenen Klimaschutzpolitik nachvollziehen können und ambitionierte Maßnahmen ergreifen“, sagt Sarah Leugers, Sprecherin von Gold Standard.
Andere, wie die Allianz der Kompensationswirtschaft, ICROA, sehen für solche Verträge keine Notwendigkeit. Die CO2-Minderung werde offiziell nur einmal – und zwar in der Klimabuchhaltung des Projektlandes – gezählt, nicht aber in der des Heimatlandes des Unternehmens. CO2-Neutralität könne daher reklamiert werden, heißt es in einem Positionspapier.
Die Diskussionen sind damit noch längst nicht beendet. Denn mit dem Pariser Klimaabkommen stellt sich eine noch grundsätzlichere Frage: Wie passt das bloße Ausgleichen von Treibhausgasen in eine Zeit, in der diese vielmehr drastisch reduziert werden müssen, um einen Klimakollaps zu verhindern? Um die 1,5-Grad-Grenze einzuhalten, müssten die Staaten ihre Emissionen bis 2030 um die Hälfte senken – jährlich etwa so viel wie im vergangenen Corona-Jahr – und sie bis 2050 nahezu auf null bringen. „Nehmen die Länder dieses Ziel ernst, wird es für Unternehmen kaum noch Bereiche geben, in denen sie ihre Emissionen ausgleichen können“, sagt Warnecke.
Überdies kommt nun auch noch CORSIA ins Spiel, das Kompensationsprogramm der Flugindustrie, mit dem bis 2035 mehr als zwei Milliarden Tonnen CO2 ausgeglichen werden sollen. Wo soll das alles geschehen? „Die Expansion des Kompensationsmarktes ist nichts anderes als eine Wette auf das Scheitern von Paris“, warnt Warnecke. Denn eigentlich dürfte es diesen Markt bis 2050 nicht mehr geben. „Wir brauchen daher einen Paradigmenwechsel“, sagt der Experte.
Klimaverantwortlich statt klimaneutral
Mit dieser Sicht ist er nicht allein. Eine Kooperation zwischen Vereinten Nationen, Unternehmen und Umweltorganisationen, die „Science Based Targets Initiative“ (SBTI), entwickelt derzeit eine Anleitung, mit der Firmen ihr Tun tatsächlich dekarbonisieren können, basierend auf einheitlichen Kriterien und ausgerichtet am Pariser 1,5-Grad-Ziel. Zuallererst – da ist die Wissenschaft eindeutig – müssten die Emissionen radikal sinken, und zwar entlang der gesamten Wertschöpfungskette, also bei der Herstellung genauso wie bei der Nutzung jedes Produkts. Erst ganz zum Schluss könnten die Firmen ihre Restemissionen über Verfahren, die CO2 aus der Atmosphäre entfernen, „neutralisieren“. Das kosmetische Rausrechnen von Treibhausgasen aber, um die Netto-Null schon jetzt oder in naher Zukunft für sich zu reklamieren, lehnt die Initiative ab.
Daraus ergibt sich ein schwieriger Spagat, schließlich will man den zahlreichen guten Klimaschutzprojekten, die es durchaus gibt, nicht den Geldhahn zudrehen. Deshalb werben neben der SBTI auch zahlreiche NGOs mit einer Neuausrichtung der Klimaschutzfinanzierung durch die Wirtschaft: Statt sich günstig freizukaufen und Klimaneutralität zu behaupten, sollten die Firmen echte Verantwortung für ihre Emissionen übernehmen. Das fängt bereits bei den zu zahlenden Beträgen an.
Demnach sollten Unternehmen ihre Emissionen mit einem angemessenen Preis pro Tonne CO2 multiplizieren. An der Kalkulation dieses Preises arbeitet die SBTI noch, bis zur Klimakonferenz im November in Glasgow soll er feststehen. Der WWF und andere empfehlen, sich dabei an den sozialen und ökologischen Kosten zu orientieren, die durch eine Tonne CO2 verursacht werden. Wie viel das ist, dazu gibt es zahlreiche Berechnungen – sie reichen von gut 40 Euro bis zu 180 Euro. Das wäre ein gewaltiger Unterschied zu jenem Preis, den Firmen heute im Schnitt für eine kompensierte Tonne CO2 bezahlen: 2,40 Euro.
Mit der Summe, die so zusammenkäme, könnten Unternehmen nicht nur weitere, eigene CO2-Einsparungen finanzieren, sondern darüber hinaus auch ambitionierte Klimaschutzprojekte, die über die bloße CO2-Zählerei hinausgehen. Das könnten zum Beispiel Anschubfinanzierungen für neue Klimatechnologien sein und Projekte, die einen Bewusstseinswandel fördern oder Nachhaltigkeit auch in anderen Bereichen bringen, wie den Schutz der Artenvielfalt und regionaler Gemeinschaften.
Das NewClimate Institute von Carsten Warnecke geht bereits diesen Weg. Es hat seine Emissionen für die Jahre 2014 bis 2020 ausgerechnet und jede Tonne mit hundert Euro multipliziert. „Wir sind der Meinung, dass dies ein guter Startpunkt ist, um Verantwortung für unsere Emissionen zu übernehmen“, sagt Warnecke. Herausgekommen sei eine Summe von 67.500 Euro, die über Atmosfair in eine spezielle Solaranlage geflossen sei. Diese liefert Strom und Wärme für eine Schule in der Mongolei, einem Land, in dem die Winter eisig sind und das noch auf Kohle angewiesen ist. Die Technologie könnte eine Alternative bieten, ist aber unter diesen Bedingungen noch nicht erprobt. „Damit wird vielleicht nicht sofort ganz viel CO2 eingespart“, sagt Warnecke, „aber wir ermöglichen eine Transformation.“
„Climate Responsibility“ nennt er diesen Ansatz: Klimaverantwortung.
Diesen Artikel finden Sie in der Ausgabe des Greenpeace Magazins 3.21 „Es ist angerichtet“. Diesmal servieren wir für unseren Schwerpunkt 50 Fragen und Antworten rund um Lebensmittel, Gesundheit, Umwelt und Ernährung. Das Greenpeace Magazin erhalten Sie als Einzelheft in unserem Warenhaus oder im Bahnhofsbuchhandel, alles über unsere vielfältigen Abonnements inklusive Prämienangeboten erfahren Sie in unserem Abo-Shop. Sie können alle Inhalte auch in digitaler Form lesen, optimiert für Tablet und Smartphone. Viel Inspiration beim Schmökern, Schauen und Teilen!
![[object Object] [object Object]](https://gpm-cs.e-fork.net/sites/default/files/styles/abo_header_cover/public/2024-07/gp05-2024_titel_rgb_96dpi.jpg?h=51520478&itok=Y_AX3dzb)